Geschichte von unten: „…und die DDR hätte auch eine ganz andere werden können“
 Was haben Soldatenräte, Grundsicherung, Entmilitarisierung oder die Übernahme von Fabriken durch Arbeiter mit dem Mauerfall zu tun? Für Herbert Mißlitz eine ganze Menge. „Doch die Linke im Westen hat damals nicht erkannt, welche historische Chance sie hatte“, sagt der Historiker, Osteuropa-Wissenschaftler und ehemalige Mitarbeiter in der DDR-Volkskammer. Während eines kleinen Zeitfensters – von Anfang 1989 bis März 1990 – sei die Umsetzung eines tatsächlich demokratischen Sozialismus in der DDR möglich gewesen. „Diese Chance ist aber durch mangelnde gesamtpolitische Verantwortung verspielt worden“, meint der gelernte Stuckateur. Bis auf wenige Ausnahmen seien keine West-Linken in den Osten gereist, um ihre Genossen zu unterstützen. Mißlitz, gebürtiger Ost-Berliner, gehört zu den Akteuren im damaligen Aufbruch. Er verweigerte den Wehrdienst, organisierte unabhängige Bildungszirkel und schloss sich den „Gegenstimmen“ an. Beim Jour Fixe der Hamburger Gewerkschaftslinken legte er seine Version der Wende dar.
Was haben Soldatenräte, Grundsicherung, Entmilitarisierung oder die Übernahme von Fabriken durch Arbeiter mit dem Mauerfall zu tun? Für Herbert Mißlitz eine ganze Menge. „Doch die Linke im Westen hat damals nicht erkannt, welche historische Chance sie hatte“, sagt der Historiker, Osteuropa-Wissenschaftler und ehemalige Mitarbeiter in der DDR-Volkskammer. Während eines kleinen Zeitfensters – von Anfang 1989 bis März 1990 – sei die Umsetzung eines tatsächlich demokratischen Sozialismus in der DDR möglich gewesen. „Diese Chance ist aber durch mangelnde gesamtpolitische Verantwortung verspielt worden“, meint der gelernte Stuckateur. Bis auf wenige Ausnahmen seien keine West-Linken in den Osten gereist, um ihre Genossen zu unterstützen. Mißlitz, gebürtiger Ost-Berliner, gehört zu den Akteuren im damaligen Aufbruch. Er verweigerte den Wehrdienst, organisierte unabhängige Bildungszirkel und schloss sich den „Gegenstimmen“ an. Beim Jour Fixe der Hamburger Gewerkschaftslinken legte er seine Version der Wende dar.
Von Kerstin Völling
Er ist ein Schnellsprecher. Er kann in 90 Minuten ganze Bücher erzählen. Das macht es nicht immer leicht, ihm zu folgen. Zumal er gern ergänzt. Etwa durch Einschübe. Die müssen sich dann auch nicht zwangsläufig auf der gleichen Zeitschiene befinden. Egal. Die Leidenschaft bricht nun mal durch. Die Leidenschaft eines Aktivisten. „Wir glaubten, die DDR sei reformierbar, die BRD aber nicht“, erklärt Herbert Mißlitz. Und wer ihn jetzt in die „Ewig-Gestrigen“-Ecke stellt, ist zu vorschnell. „1987 sprachen sich alle, wirklich ALLE oppositionellen Gruppen in der DDR für den Sozialismus aus.“ Da hat er recht. Denn wenn er „1987“ sagt, meint er den ersten „Kirchentag von unten“. Der entstand in Berlin, und zwar durch die Besetzung der Pfingstgemeinde-Kirche am Kotikowplatz. „Wir haben uns dort getroffen, weil auch die christlichen Gruppen mittlerweile die Nase voll davon hatten, dass ihre Kirchenleitung vor der SED immer wieder in die Knie ging.“ Zuvor war die Evangelische Kirche so etwas wie ein Zufluchtsort für Staatskritiker geworden. „Die SED-Führung akzeptierte einen gewissen Freiraum, soweit es sich um innerkirchliche Diskussionen handelte“, erklärt Mißlitz. Unabhängige Blätter wie der „Friedrichsfelder Feuermelder“ entstanden. Was sprachlich und thematisch nicht so ganz genau in den Rahmen passte, wurde passend gemacht: „Christen wie Marianne Birthler etwa waren zwar auch obrigkeitstreu. Birthler aber teilte uns mit, wie wir etwas formulieren mussten, damit es nicht der Zensur zum Opfer fiel.“ Direkten Kontakt habe seine Gruppe zu Rolf Reißig gehabt.
1987 aber war nun die traditionelle Friedenswerkstatt abgesagt worden. Das brachte das Fass zum Überlaufen. „Allerdings hatten wir nicht mit soviel Andrang in der Pfingstgemeinde gerechnet. Bei 6000 Besuchern platzte das kleine Gebäude aus allen Nähten. Da haben wir dann noch zusätzlich die Galiläa-Gemeinde in der Rigaer Straße besetzt.“ Die Besetzungen seien von den Pastoren mehr oder weniger geduldet worden. Drei Tage lang habe es in den Gotteshäusern deshalb eine pulsierende Mischung aus Politik, Kultur und Musik – auch Punkmusik – gegeben. „Das war der Startschuss für das Netzwerk, aus dem später dann die Bürgerrechtsgruppen entstanden“, sagt Mißlitz. Ziel sei damals gewesen, eine Form der politischen Analyse ohne ideologisches Korsett zu finden. „Und da gab es ganz verschiedene Ansätze. Trotzkisten, Spartakisten, Ökologiegruppen mischten sich. Aber auch christliche Sozialisten waren dabei, die in der DDR stark vertreten waren.“ Manche von denen hätten gar behauptet, Martin Luther sei ein Sozialist gewesen.
Der nächste Meilenstein für die Ost-Opposition folgte mit der Berliner Anti-IWF-Aktionswoche im September 1988. Mißlitz: „Da gab es auch Geschichtskreise und Arbeitsgruppen, in denen wir mit SED-Genossen über Glasnost und Perestroika offen diskutiert haben.“ Einige hätten die These vertreten: „Glastnost ja, Perestroika nein.“ Es habe gar Treffen mit Leuten aus dem Umfeld des Politbüros gegeben. „Merkwürdigerweise schätzten die schon damals das sozialistische Potential in der DDR geringer ein als wir.“ Am Ende der Woche habe es erstmalig eine konzertierte Aktion mit einer gemeinsamen Erklärung von Ost- und Westgruppen gegeben. „Die Mauer wurde immer löchriger“, beschreibt Mißlitz. Aus dem Großteil der unterzeichnenden Ost-Gruppen sei dann später die Vereinigte Linke entstanden, die auch zu den Volkskammerwahlen angetreten sei. Kontakte zu Westgruppen wie etwa den Autonomen und der Antifa festigten sich. „Wir hatten schon konkrete Perspektiven entwickelt, wie etwa eine Grundsicherung oder ein Rätesystem innerhalb Volksarmee“, sagt Mißlitz. Er selbst war Ende der 70er Jahre in Untersuchungshaft genommen worden, weil er mit der Begründung, die Volksarmee sei mit ihrer hierarchischen Struktur keine Arme des Volkes, den Wehrdienst verweigert hatte. Das mag in der Retrospektive zunächst abenteuerlich klingen. Doch ein Bericht des NDR zeigt, wie weit die Umsetzung der Rätestrukturen in der Volksarmee zur Wendezeit schon fortgeschritten war. „Kurz nach dem Mauerfall herrschte eine Art Anarchie in der DDR. In Leuna sind wir in die Betriebe gegangen und haben die Arbeiter aufgefordert, die Unternehmen zu übernehmen.“ Eine ernüchternde Erfahrung. (Anmerkung Syndikalismus-Blog: Dss Anarchie nicht herrscht, sondern der Gegensatz davon ist, muss hier einmal wieder ausgeprochen werden.) „ Die Leunawerke befanden sich in einem erbärmlichen Zustand. Wasser trat durch die Wände ein, und die Arbeiter mussten beispielsweise Quecksilberrückstände mit bloßen Händen wegkarren.“ Einer der Arbeiter habe zu ihm gesagt: „Bringt das erst einmal in Ordnung. Dann können wir auch über die Übernahme des Betriebes reden.“
Dennoch ist Mißlitz auch heute noch der Überzeugung, dass für die Linke mehr drin gewesen wäre. Denn während alle anderen Gruppierungen oder Parteien Unterstützung aus dem Westen erhielten, sei von der radikalen Linken gar nichts gekommen. Mißlitz: „Das war sehr enttäuschend. Wir hatten immer gedacht, dass die westliche Linke sehr weit entwickelt war.“ Das Gegenteil sei jedoch der Fall gewesen. Die Vereinigte Linke konnte letztendlich nur einen Sitz in der neu gewählten Volkskammer der DDR ergattern. „Dann begann der Ausverkauf“, sagt Mißlitz. Die Soldatenräte seien vom frisch gewählten Minister für Abrüstung und Verteidigung, Rainer Eppelmann, untersagt worden. „West-Agenten boten allen, die sich noch für die Rechte der DDR-Bürger einsetzten, Pöstchen und Jobs an. Das sprengte auch den letzten Widerstand.“ Ihm selbst sei ein Job im Bundesrechnungshof angeboten worden. Mißlitz lehnte ab und schlug sich erst einmal mit einer ABM-Stelle durch. Heute ist er Leiter eines Osteuropaservices.
Zur Lektüre empfiehlt Mißlitz das Buch „Parteien und politische Bewegungen im letzten Jahr der DDR“ von Berndt Musiolek und Carola Wuttke (Basis-Druck).
Quelle: Der Spotnik











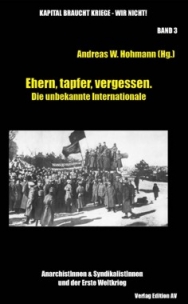

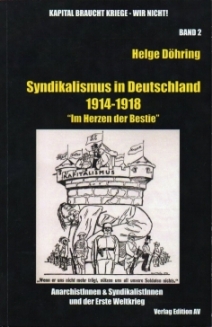


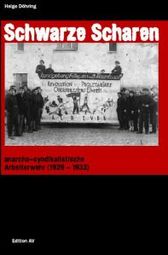



http://www.ddr89.de
http://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/boheme/start.htm
Vater der Digedags ist tot
Mosaik-Schöpfer Hannes Hegen ist tot. Er starb bereits am Sonnabend in Berlin. Hegen schrieb und zeichnete 20 Jahre lang Dig, Dag und Digedag in Raum und Zeit.
http://www.mdr.de/kultur/koepfe/hannes-hegen106.html
http://www.mosapedia.de/wiki/index.php/Hauptseite
„Ist unser Traum in Erfüllung gegangen?“
25 Jahre Mauerfall Anlässlich des Jubiläums wollen wir von Shermin Langhoff, Julia Franck und Katja Petrowskaja wissen, wie sich Deutschland verändert hat. Ist es ein neues Land geworden?
An diesem geschichtsträchtigen Sonntagmorgen des 9. November herrscht im Gorki-Theater ein wenig Aufregung. Shermin Langhoff, die Intendantin, unterstützt mit ihrem Haus die Aktion „Erster Europäischer Mauerfall“ des Zentrums für politische Schönheit. Rund 100 Aktivisten sind an die Außengrenze der EU gefahren, um sie mit Bolzenschneidern zu zertrennen; und auch, um am Spreeufer entwendete Mauerkreuze dort wieder aufzustellen. Die Aktion schlägt hohe Wellen. Shermin Langhoff steht in ständigem Kontakt mit den Aktivisten. Während wir sitzen und reden werden sie just die Grenze erreicht haben. Natürlich müssen wir Frau Langhoff zuerst danach fragen. Erst dann können wir über alle anderen Fragen sprechen.
Jakob Augstein: Der Präsident des Bundestags, Norbert Lammert, hat gesagt, die Aktion „Erster Europäischer Mauerfall“ wäre blanker Zynismus. Finden Sie das auch?
Shermin Langhoff: Es hat mich sehr bewegt, dass Herr Lammert das ohne einen Nebensatz gesagt hat. Er hat vergessen, auf die politische Diskussion und das Anliegen der Aktion hinzuweisen. Ich bin ehrlich gesagt sehr enttäuscht über ihn und darüber, dass an dieser Stelle keine politische Diskussion begonnen wird.
Jana Hensel: Katja Petrowskaja, Sie sind in der Ukraine aufgewachsen. Wie viel hat die EU-Außengrenze mit der Berliner Mauer zu tun?
Katja Petrowskaja: Historisch gesehen sind das für mich zwei unvergleichbare Dinge. Aber wenn man heutzutage Menschen dadurch sensibilisieren möchte, darf man die Berliner Mauer als Metapher benutzen, aber man sollte sie nicht mit anderen gleichsetzen. Sie war eine Konsequenz des Zweiten Weltkriegs und mit ihrem Fall war die Welt endlich von diesen Folgen befreit. Ich habe mich immer gefragt: Wie kann man in einem Land leben, das durch eine Mauer geteilt wird? Diese Normalität habe ich nie verstanden.
Augstein: Aber genau in der Frage nach der Normalität liegt doch die Analogie! Wie viel verbindet uns wirklich mit diesen Flüchtlingen? Empfinden wir ihnen gegenüber Solidarität oder nicht? Julia Franck, Ihr Leben war ja stets direkt mit der Mauer verbunden. Sie sind in Ostberlin geboren, mit acht in die BRD ausgereist, mit 13 allein nach Westberlin zurückgekehrt. Verstehen Sie, was Katja Petrowskaja nicht verstanden hat?
Julia Franck: Ich glaube, für diese als Normalität empfundene Anormalität gab es sehr komplexe Gründe und Ursachen. Auch ich sehe die Mauer als Konsequenz des Zweiten Weltkriegs, das aber ist in der alltäglichen politischen Wahrnehmung des Westens oft untergegangen. Ich glaube, das man dort relativ schnell dazu übergegangen ist, den Osten als so eine Art Club anzusehen, als eine Versammlung von Kommunisten, die alle ideologisch an der Mauer festhielten. Im Osten gab es andere Vorurteile, die aus einer großen Unerfahrenheit entstanden. Ich möchte das nicht als naiv belächeln, aber im Osten gab es den Glauben, dass im Westen alles möglich wäre. Die Vorstellung vom Paradies war geradezu märchenhaft. Am 9. November 1989 und an den Tagen danach spürte ich persönlich eine Beklommenheit; ich ahnte, welche Schwierigkeiten es in Bezug auf die gegenseitigen Missverständnisse geben könnte.
Augstein: Aber die gibt es doch immer noch. Wenn Bernd Ulrich in der Zeit schreibt, die Linkspartei sei wie die AfD. Sein Vorwurf: Die Linke relativiere das westdeutsche System, indem sie immer wieder frage: Welche Grade der Freiheit gibt es hier wirklich, welche Grade der Unfreiheit gab es in der DDR? Diese Sicht auf die Geschichte und auf das System des Westens wird von Bernd Ulrich damit total diffamiert, indem gesagt wird, ihr verwischt den zentralen Unterschied. Was sagt Ihnen das?
Franck: Was ist denn der zentrale Unterschied?
Augstein: Ich weiß es nicht, das ist ja nicht meine Haltung. Ich vertrete da, obwohl ich Westdeutscher bin, auch eher eine kritische Außensicht. Und das ist ja im Grunde der Vorwurf: Ihr stellt euch außerhalb des Systems und vergleicht ganz nüchtern, anstatt es mit allen Mitteln zu verteidigen. Genau das ist die Lammert-Reaktion.
Franck: Ich glaube, es gibt ein Missverständnis im Idealbild der westdeutschen Linken über die Verhältnisse in der DDR. Deshalb fallen die Reaktionen auf den Biermann-Auftritt im Bundestag auch so überempfindlich aus. Biermann ist ja vorsätzlich in die DDR gezogen, weil er Kommunist war. Irgendwann war er total entsetzt und empört darüber, wie sich der Kommunismus in der DDR gebärdet hat. Ganz konkret über die Staatssicherheit, über die Reglementierung. Für die westdeutschen Linken waren die Flüchtlinge aus der DDR Verräter der linken Ideologie oder Verfolgte, von denen sie forderten, ihr Verfolgtsein zum Thema zu machen. Ich denke da nur an Thomas Brasch, der sich gegen diese Vereinnahmung immer gewehrt hat.
Hensel: Offenbar verlieren West- und Ostdeutsche da an Differenziertheit, die Konflikte zwischen beiden Seiten nehmen wieder zu, indem die Dinge wieder viel stärker gegeneinandergesetzt werden. Shermin Langhoff, verstehen Sie das? Interessiert Sie das?
Langhoff: Ich würde da gerne noch einen Aspekt hinzufügen. Nämlich die Frage nach Demokratie oder Kapitalismus. Wir sprechen gerade von einem System, das sich in einer Krise befindet. Wegen unseres Systems stirbt jede fünf Sekunden ein Kind an Hunger. Und zwar nicht mehr, wie Karl Marx es analysiert hat, weil die Produktionsgüter fehlen, sondern weil unser System nicht will, dass sie gerecht verteilt werden. Was für ein System wird denn da verteidigt? Eins, das nicht funktioniert. Das die Grundlagen, nämlich Menschenrechte und Freiheit, mit Füßen tritt. Ich glaube, es ist wichtig, die Selbstreflexion unseres Systems einzufordern. Wie kann es sein, dass der Sozialismus das größte Problem zu sein scheint und die linke Opposition von Joachim Gauck und Wolf Biermann angegriffen wird? Wir haben kein Problem mit dem Sozialismus, wir haben ein Problem mit dem Kapitalismus.
Augstein: Biermann und Gauck teilen jene Haltung, nach der die Abwesenheit der DDR gleich Freiheit ist. Für sie ist das Problem damit erledigt, die Revolution ist ja erfolgreich gewesen.
Petrowskaja: Aber das ist auch so.
Augstein: Aber ist das nicht letztlich das Thema, über das wir hier sprechen. Wir Autoren, Künstler, Theaterleute und Journalisten haben im Grunde alle den gleichen Job: Die Verhältnisse zu verändern und zu verbessern. Wir müssen für die Revolution hier sorgen, jene Revolution, die Sie, Katja Petrowskaja, auf dem Maidan hatten. Und wenn jemand sagt: Wir hatten ja im Osten schon eine Revolution und brauchen deshalb keine mehr, dann reicht mir das nicht.
Hensel: Aber es ist doch so: Wir in der DDR oder in der Ukraine haben eine Revolution gemacht, ihr im Westen redet nur darüber. Und am Ende sollen wir schuld sein, dass wir unsere gemacht haben und eure noch ausbleibt?
Petrowskaja: Ich störe mich an diesem „wir“. Ich glaube, Zugehörigkeit ist etwas, das man selbst wählt. Egal, wie man von außen beschrieben wird. Ich bin übrigens kein Migrant. Ich bin einfach gekommen. In meinem Fall war es aber auch einfach möglich.
Hensel: Sie sind ja der Liebe wegen nach Berlin gekommen, nun haben Sie Ihren Roman auf Deutsch geschrieben. Haben Sie gewusst, worauf Sie sich hier einlassen?
Petrowskaja: Das ist nicht wichtig. Im Leben hat man immer eine gewisse Vorstellung, einen gewissen Traum, Realität aber ist etwas anderes. Es wäre ein Denkfehler, Traum und Realität zu vergleichen. Die Deutschen fragen sich: Sind wir zufrieden mit der Wiedervereinigung oder sind wir es nicht? Natürlich nicht. Aber ist der Traum in Erfüllung gegangen? Natürlich, ja, das ist er!
Augstein: Julia Franck, Sie haben zwei Kinder. Wie erklären Sie denen die deutsche Teilung?
Franck: Nun, ich stelle mich nicht als Lehrerin vor meine Kinder und erteile ihnen eine Lektion. Ich erzähle ihnen eher manche Dinge, zum Beispiel wie der Bahnhof Friedrichstraße früher aussah und wie die Grenzübertritte vonstattengingen. Meine Urgroßmutter musste einmal ihre Brücken und Zähne an der Grenze rausnehmen lassen, weil man sie verdächtigte, Mikrofilme zu schmuggeln. Sie hatte Freunde und Verwandte in Israel, Frankreich, England, Amerika – und genoss als Jüdin in der DDR immer Reisefreiheit. Ihr einer Sohn lebte seit 1936 in Amerika, der andere in Wiesbaden, zwei Töchter in der DDR. Die Reparatur des Gebisses hat sehr lange gedauert und konnte nur durch die Hilfe eines Kieferorthopäden im Westen gelingen. Diese Episode zeigt deutlich, wie damals an diesen Grenzübergängen Macht demonstriert und auch Angst und Verunsicherung verbreitet wurden. Im Grunde zeigt sich hier ganz deutlich das Wesen dieser Diktatur.
Augstein: Zeigen Sie Ihren Kindern auch Bilder von der spanischen Exklave Melilla?
Franck: Natürlich schaue ich mir mit meinen Kindern auch Bilder von Flüchtlingsbooten an und wir sprechen darüber, was es bedeutet, nach Europa kommen zu wollen. Wir haben sehr viele kritische Gespräche über all das, was Menschen anderen Menschen antun.
Hensel: Shermin Langhoff, eine Ihrer Losungen im Gorki-Theater lautet: Nehmt Geschichte persönlich! Müssen wir ein neues Bewusstsein dafür schaffen, wie sehr wir in unserem Sein durch historische Ereignisse und Verläufe noch immer beeinflusst werden?
Langhoff: Wir sitzen hier in einem geschichtsträchtigen Haus, auf historisch kontaminiertem Boden. Daraus erwächst auch die Verantwortung, Geschichte persönlich zu nehmen. Das habe ich, die ja erst Deutsche werden musste, alles sehr ernst genommen. Deswegen sitze ich hier. Deswegen mache ich Theater. Das ist meine Motivation.
Augstein: Schaffen Sie es auch, sich gegen die tagespolitische Instrumentalisierung von historischer Erinnerung zu wehren?
Langhoff: Ich kann gar nicht anders, als mich wehren. Viele Menschen haben ihr Leben für die Demokratie gelassen, aber vermutlich nicht für die, die wir gerade erleben. Das nehme ich persönlich. Ich bin migriert und wenn wir heute in dieser Stadt über Freiheit und Grenzen sprechen, dann tun wir das aus einem postmigrantischen Moment heraus. Die Stadt besteht nicht nur aus sogenannten Ost- und Westberlinern, sondern auch aus den Neu-Berlinern.
Franck: Ich bin ja in Berlin aufgewachsen. Manche meiner alten Freunde sagen: Dieses Mitte, der Prenzlauer Berg, ich könnte da nicht mehr wohnen, da sind ja nur noch Touristen. Aber ganz ehrlich: Ich bin wahnsinnig froh darüber. Die Stadt hat sich durch die Menschen, die in den letzten 25 Jahren hierher gezogen sind, zu etwas Eigenständigem entwickelt. Jeder bringt sein eigenes Bild von Berlin mit und erzählt dadurch, was die Stadt für ihn sein könnte.
Petrowskaja: Gerade wegen des Zweiten Weltkriegs und der Mauer ist diese heutige Normalität nun wiederum für Berlin viel spürbarer und wertvoller als vielleicht in anderen Städten der Welt. Es gibt hier einen Konsens darüber, was Gut und Böse ist. Ich kam im Jahr 1999 aus Moskau und hatte im Gepäck ein erstickendes Gefühl aus verlorener Freiheit und Unbehagen über die Entwicklungen in der ehemaligen Sowjetunion. Und dann sah ich, was hier in Berlin erreicht wurde. Ich glaube, Deutschland braucht manchmal Ausländer, um zu verstehen, wie wunderbar Normalität sein kann. Natürlich gibt es Defizite in dieser Stadt. Aber es ist eine der friedlichsten Städte Europas; und es ist auch kein Zufall, dass hier heutzutage mehr als 30.000 Israelis wohnen. Das ist doch unglaublich!
Langhoff: Mir geht es genauso. Ich habe im deutschen Geschichtsunterricht über den Holocaust von dem Genozid an den Armeniern erfahren. Hier gibt es die Möglichkeit, zu erinnern und Konsequenzen zu ziehen. Da ist unser Land viel weiter als andere. Zum Beispiel in der Türkei, wo ich herkomme, gibt es riesige und schmerzhafte Lücken in der Erinnerung. Dass das einem Land nicht guttut, kann man deutlich sehen. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass es eine gegenläufige Genealogie gibt, an die wir an diesem 9. November erinnern müssen. Dass zum Beispiel die Kommunisten, die dem Faschismus Widerstand geleistet haben, diejenigen waren, die nach dem Krieg als Erste wieder ein Berufsverbot im Westen bekamen. Und wir wissen aus der NSU-Geschichte, wie weit Gedanken, bestimmte Strukturen in den Institutionen verwurzelt waren und sind. Das sind Fakten, die wir nicht ausblenden dürfen, auch wenn es uns gelingt, unsere Geschichte zu erinnern und Mahnmale zu errichten.
Hensel: Wenn ich Sie reden höre, frage ich mich, warum Sie dieses Theater machen. Ich bin ja ein großer Fan dieses Theaters, weil ich finde, es basiert auf einem ganz einfachen Gedanken: Sie holen jene Realität, die auf der Straße stattfindet, endlich so selbstverständlich auf die Bühne wie kaum ein anderes. Ich frage das, weil Sie Katja Petrowskaja beigepflichtet haben, dass Deutschland so viel geschafft hat. Aber wenn es so wäre, müsste es Sie nicht geben. Oder anders gesagt, es gäbe viel mehr als nur Sie.
Langhoff: Man darf nicht vergessen, dass Hybridität in der Kultur gerne gesehen wird. Ich wurde in den vergangenen Jahren viel gelobt und gestreichelt, aber Sie sehen nun, sobald ich mein Terrain verlasse, wird es problematisch. Eines ist dabei wichtig zu sagen: Die gleichen Rechte gibt es da draußen immer noch nicht. Ich habe vor 30 Jahren in einer Kampagne Modell gestanden, die für ein kommunales Wahlrecht für Ausländer warb. Nach wie vor ist das in der Bundesrepublik immer noch nicht durchgesetzt. Das heißt, dass ein Mensch, der hier mitunter seit Jahrzehnten wohnt, nicht über den Spielplatz auf der anderen Straßenseite mitbestimmen kann. Das heißt, es gibt keine Rechte, die gewonnen sind. Insofern liegt da noch viel vor uns.
Petrowskaja: Ich bin seit 15 Jahren im Prenzlauer Berg und kann nicht lokal wählen, wie viele, viele andere auch. Es ist skandalös.
Franck: Das gilt nicht nur für das Wahlrecht, sondern auch im Bildungssektor. Hier stehen Migranten nicht dieselben Möglichkeiten offen. Da ist noch viel zu tun. Aber ich würde auch sagen, dass Deutschland im Vergleich zu den USA oder Osteuropa ein Boden ist, auf dem Veränderungen stattfinden können. Hier können bestimmte Dinge diskutiert werden und Menschen wie Shermin Langhoff treten streitbar auf, ohne sich hinter politischen oder parteilichen Etiketten zu verstecken. Diese Offenheit gründet auch in unserer Geschichte und darin, wie wir mit Geschichte umgehen mussten. Da verstehe ich, warum man nach Berlin kommt, und ich verstehe, warum Deutschland so attraktiv ist, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern.
Augstein: Es gibt einen Begriff, über den wir noch nicht genug geredet haben, nämlich Identität. Wir beobachten momentan eine Re-Muslimisierung von bestimmten migrantischen Schichten. Wir beobachten eine Re-Ossifizierung. Leute kommen zurück zu ihrer ostdeutschen Identität.
Hensel: Ich beobachte eine Re-Wessifizierung. Es erscheinen Texte, in denen steht, wie schön es war, als Helmut Kohl Deutschland regierte. Nach dem Motto: Ein Mann war noch ein Mann und Geld war noch Geld.
Augstein: Aber das ist doch eine beunruhigende Beobachtung! Oder ist das eine fast zwangsläufige Entwicklung?
Franck: Natürlich gibt es diese Tendenzen. Natürlich erschrecke ich auch, wenn ich in der U-Bahn zwei ganz offensichtlich westdeutsche Menschen höre, die völlig ungehemmt darüber schimpfen, wie fürchterlich dieser Osten und diese Ostdeutschen sind. Das finde ich pittoresk, dafür fahre ich U-Bahn. Den Menschen so auf den Mund schauen, das können Zeitungen ja kaum. Persönlich habe ich mich nie dazu aufgerufen gefühlt, mich für die eine oder die andere Seite entscheiden zu müssen oder in irgendwelche Parteien einzutreten.
Langhoff: Ja, es scheint eine Identitätssuche, eine Sinnsuche zu geben. Ich glaube, wir haben es aber vor allem mit dem Effekt zu tun, ständig zu etwas anderem gemacht zu werden. Seit dem 11. September 2011 werde ich überhaupt erst als Muslima gesehen. Ich bin aber gar keine Bekennerin! Ich bin Agnostikerin und war lange überzeugte Atheistin. Nun musste ich auf einmal als aufgeklärter Mensch, der gelernt hat, Minderheiten zu beschützen, die „Muslime“ und den „Islam“ verteidigen. Was mir manchmal wirklich schwerfällt. Es gibt Statistiken, die besagen, dass 40 Prozent der Deutschen es sich nicht vorstellen können, dass eine Deutsche ein Kopftuch trägt. Das sind nicht alles Rassisten, aber mit dieser Vorstellung können wir nicht umgehen. Manchmal denke ich darüber nach, ob ich nicht anfangen sollte, auch ein Kopftuch zu tragen! Aber diese Entwicklung liegt meiner Meinung auch daran, dass von der Politik ein bestimmtes Islambild konstruiert und geschaffen wird. Dabei geht es immer auch um ökonomische Interessen; jene Interessen, die dann zu Vorurteilen werden à la: Wir Westdeutschen haben jetzt 25 Jahre die Ossis finanziert! Oder: Die Türken nehmen uns die Arbeit weg und schaffen das ganze Geld in die Türkei! Es ist der ökonomische Kontext, der Identitäten viel stärker neu konstruiert, als wir glauben. Das verbindet dann Türken und Ostler.
Petrowskaja: Ich finde es ganz wichtig zu fragen, zu welchem „wir“ gehöre ich? Und wer sind diese anderen? Was mich in Deutschland wundert, ist: Warum wird ständig über die Ossis gesprochen? Man redet einerseits über die brutale und schmerzhafte Teilung Deutschlands, andererseits spricht man über Ossis und Wessis, als wäre es eine fertige Form, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat. Dabei sollte es so sein, als hätten sich beide ohne den anderen nicht vollkommen gefühlt. Auch ich bin übrigens in letzter Zeit immer mehr zur Ukrainerin und Jüdin geworden. Ständig werde ich gefragt, ob ich Ukrainerin oder Russin bin, und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich antworten soll. Warum entweder oder? Identität ist tatsächlich dann eine Freiheit, wenn man nicht in etwas hineingezwungen wird. Identität sollte etwas sein, das man sich selbst schafft und das man selbst annehmen kann.
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/ist-unser-traum-in-erfuellung-gegangen
Wer war wer in der DDR? ist ein biografisches Nachschlagewerk, das erstmals 1992 im Ch. Links Verlag erschien. Die ersten Auflagen wurden von dem Historiker Jochen Černý herausgegeben und umfassten rund 1.500 Einträge zu Personen des öffentliches Lebens der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Das Lexikon vermerkt die Stellung der jeweiligen Persönlichkeit innerhalb des gesellschaftlichen Systems der DDR und gibt ihr Leben in einer kurzen Zusammenfassung wieder. Über ein Autorenkürzel lässt sich der Verfasser der jeweiligen Kurzbiografie recherchieren.
1996 erschien eine digitalisierte Ausgabe auf drei Disketten mit 2146 Biographien zur DDR-Geschichte, die von dem Historiker Bernd-Rainer Barth herausgegeben wurde.
Im Laufe der Jahre wurde Wer war wer in der DDR? konzeptionell überarbeitet und stark erweitert. Im Jahr 2000 druckte die Bundeszentrale für politische Bildung eine kostenlose Sonderausgabe. Die Ausgabe von 2006 („1. Aufl. der 4. Ausg.“) umfasst ebenso wie die aktuelle fünfte Auflage zwei Bände. Sie trägt den Untertitel: „Ein Lexikon ostdeutscher Biographien“ und wurde herausgegeben von Helmut Müller-Enbergs, Jan Wielgohs, Dieter Hoffmann und Andreas Herbst. Im März 2010 erschien die fünfte Ausgabe[1] mit insgesamt fast 4.000 Biografien.
Parallel zur gedruckten Fassung bietet die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur eine Online-Version zur kostenlosen Recherche an.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Wer_war_wer_in_der_DDR%3F
http://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html
http://www.christoph-links-verlag.de/pdf_output.cfm?titel_id=561
DDR 1988: Peter Wensierski über den Film „Bitteres aus Bitterfeld“
Bitteres aus Bitterfeld. Eine Bestandsaufnahme, allgemein kurz Bitteres aus Bitterfeld, ist der Titel eines illegal in der DDR gedrehten Dokumentarfilms aus dem Jahr 1988. Er zeigte das Ausmaß der Umweltverschmutzung in der von Chemiebetrieben geprägten Industrieregion um Bitterfeld. Dieser Versuch, Gegenöffentlichkeit herzustellen, war ein gemeinsames Vorhaben Ost-Berliner Oppositioneller des Grün-ökologischen Netzwerkes Arche, örtlicher Umweltschützer und West-Berliner Filmemacher.
Das Video war zunächst in privaten und kirchlichen Kreisen in der DDR zu sehen. Auszüge strahlte erstmals das ARD-Magazin Kontraste im Herbst 1988 aus; sie wurden von vielen Fernsehstationen im Ausland übernommen. In Bitterfeld war die Sendung Tagesgespräch. In der DDR machte sie das Netzwerk Arche bekannt. Der DDR-Staatssicherheit gelang es nicht, die an der Herstellung des Films Beteiligten zu überführen. Nach der Wende orientierte sich die Berichterstattung deutscher und ausländischer Journalisten über die Lage im „Chemiedreieck“ an diesen Filmausschnitten.
mehr http://de.wikipedia.org/wiki/Bitteres_aus_Bitterfeld
Ein Fernsehbeitrag rüttelt auf „Bitteres aus Bitterfeld“
Umweltsünden in der DDR konnte man riechen, schmecken, sehen. Und doch versuchten Regierung und Stasi gemeinsam, das tatsächliche Ausmaß der Zerstörung zu verbergen. 1988 gelang einer Gruppe von Umweltaktivisten das scheinbar Unmögliche: Sie drehten ein Video über die katastrophale Umweltsituation der Region Bitterfeld und veröffentlichten es sogar im Westfernsehen.
weiter http://www.mdr.de/damals/archiv/artikel95380.html
DDR 1989: Volksdroge Alkohol Ein Film von Peter Wensierski
Der Film entstand im Juni 1989. Auch zu diesem Problem der DDR-Gesellschaft gab es keine öffentliche Diskussion. Interviewpartner ist u.a. die ehemalige Ost-Berliner Psychologin Angela Modler
Fasse dich kurz ✆ Telefonieren in der DDR
Von Klingelfeen und Stöpselmiezen, eisernen Jungfrauen und Roten Telefonen, von ungewöhnlichen Telefonaten und gewagten Verbindungen. Das Fernsprechwesen – es entwickelt sich. Nur nicht so, wie Millionen DDR-Bürger es sich erhoffen. Auf ein Telefon warten manche länger als auf einen Trabi. Und viele bekommen nie eines. 1989 zählt man gerade elf Anschlüsse auf 100 Bürger. 95 Prozent der Ortsvermittlungstechnik tut schon seit 60 Jahren Dienst.
Die sonst so medaillenverliebte DDR hat hier eindeutig die rote Laterne. Am Anfang stöpseln noch die legendären Fräuleins vom Amt die raren Verbindungen, flicken wagehalsige Entstörer die blanken Leitungen, stehen Schlangen vor ewig kaputten Münzfernsprechern. Weil die Verbindungen der Post nie ausreichen, entstehen mindestens 23 nichtöffentliche Fernmeldenetze – für die Stasi, das Militär, die Kombinate …
Störungen im öffentlichen Netz stehen an der Tagesordnung und einheitliche Vorwahlnummern gibt es nicht. Doch wer endlich einen privaten Anschluss bekommt ist glücklich und nimmt auch in Kauf, den Anschluss mit bis zu vier „Teilnehmern“ zu teilen. Und mit gigantischem Aufwand hört dann manchmal auch die Stasi mit. Telefonieren in der DDR. Ein langer Weg vom „Fasse dich kurz“ bis zum „Ruf mal an“. Von der Stunde Null im Frühjahr 1945, als die Sieger die letzten Leitungen kappten, bis zu den Piratenstreichen der Wendezeit reicht der Bogen einer Geschichte, über der, wie überall in der DDR, der Satz steht: Not macht erfinderisch.
Leidgeprüfte „Teilnehmer“ oder solche, die es endlich werden wollten, gestandene Postler aus Mühlhausen, Leipzig und Dresden, der letzte Postminister, Günter Schabowski und viele andere berichten über große Probleme und kleine Schritte beim Telefonieren in der DDR
Neue Perspektiven in der Forschung — Die DDR als Chance?
Von Jochen Stöckmann
Der inzwischen abgerissene Palast der Republik, einst Sitz der DDR-Volkskammer, in Berlin
Was für ein Staat war die DDR? Darüber streiten die Historiker.
(Archivfoto von 1990 – picture alliance / ZB / Hubert Link)
Beitrag hören >>> http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2016/03/02/drk_20160302_1915_42061d73.mp3
Der US-Historiker Andrew Ian Port kritisiert das in Deutschland herrschende Geschichtsbild von der DDR. Ihm geht es um regionale Unterschiede und kritisiert unter anderem, sich zu stark auf die Recherche der Stasi-Akten zu verlassen.
„Wir wissen, dass die DDR keinen verbrecherischen Krieg geführt hat. Wir wissen, dass die DDR keinen Massenmord betrieben hat, keinen Genozid. Das ist nichts Neues, dazu hätte es 25 Jahre DDR-Forschung nicht gebraucht. Also sollten wir versuchen, eher die DDR als Chance zu begreifen und neue Wege oder andere Wege dann auch mal zu gehen.“
Was Dierk Hoffmann als Quintessenz seiner nunmehr dritten Expertise zu den Perspektiven der DDR-Forschung vorträgt, bleibt im Ungefähren, ist kaum mehr als ein unsicheres Vorantasten. Aber der Begriff lässt aufhorchen: die DDR als Chance? Welche Chancen bietet die so intensiv erforschte DDR noch für Historiker? Der US-Historiker Andrew Ian Port sagt:
„Ich war hier in Berlin, als die Mauer fiel. Ich bin hier zwei Jahre rumgereist, habe mit Leuten gesprochen, wollte wissen, wie es damals war. Ich finde aber, wenn man einfach auflistet, was noch nicht erforscht worden ist, das ist nicht besonders spannend. Nicht jeder weiße Fleck muss koloriert werden, es gibt manche, die einfach uninteressant sind.“
Port ist unter den 18 Historikern, die im Sammelband „Die DDR als Chance“ ihre pointierte Meinung zu der Expertise vertreten. Zusammen mit seiner englischen Kollegin Mary Fulbrook kritisiert er die deutsche Lehrmeinung von der DDR als einem vorgegebenen Puzzle, in das nur noch fehlende Teile eingefügt werden müssten.
Die Dominanz der Platzhirschen in der DDR-Forschung
Sein Geschichtsbild ist komplexer, verändert sich im Laufe der Forschung. Etwa bei der geduldigen, jahrelangen und scheinbar völlig unspektakulären Lektüre von Gewerkschafts- und Betriebsarchiven im thüringischen Saalfeld. Port hat dabei etwas erfahren, was nicht zum herrschenden DDR-Bild passt:
„Dieser Unmut, dass die Leute wirklich kein Blatt vor den Mund gehalten haben! Und das hat mich als Amerikaner, als Westler, der gedacht hat, dass alle wie die Schäfchen da im Osten gelebt haben, das hat mich wirklich umgehauen.“
Aus diesem Erlebnis, diesem Forscherglück, hat Andrew Port seinen Ansatz entwickelt und die „rätselhafte Stabilität der DDR“ analysiert. Eine Fragestellung, unter der auch die angeblich „überforschten“ Aktenbestände neu zu sichten wären. Mit einer Methode, die sich dem Blick der angelsächsischen Historiker verdankt:
„New cultural history, neue kulturelle Geschichte! Nicht, wie die Leute gelebt haben, wie es ihnen wirtschaftlich ging. Sondern: wie haben sie die Welt betrachtet – und wie hat diese Betrachtungsweise ihre Aktionen, ihr Benehmen wesentlich beeinflusst.“
Als Wissenschaftler aus dem gewissermaßen „neutralen“ Ausland bleibt Port unvoreingenommen, wenn es um politisch aufgeladene deutsche Debatten geht wie etwa die Zukunft der Stasi-Unterlagenbehörde. Er sieht das eher pragmatisch:
„Ich war zwei Jahre in Rudolstadt, Saalfeld. Man muss nicht ins Stasi-Archiv gehen.“
Was den Historiker mit Abschlüssen in Harvard und Yale dagegen mächtig aufregt, das ist die Dominanz von Platzhirschen in der DDR-Forschung, des Instituts für Zeitgeschichte und des Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam.
„Die zitieren sich alle gegenseitig und was im Ausland erscheint wird überhaupt nicht wahrgenommen. Da steht in dieser Expertise: ‚Wir brauchen Lokalstudien über Aushandlungsprozesse zwischen Herrschern und Beherrschten.‘ Das ist genau das Thema meines Buches!“
Andrew Port hat für Streit gesorgt
Ports Buch wurde von zwei Autoren der Expertise, Dierk Hoffmann und Hermann Wentker, sogar rezensiert. Aber die deutschen Kollegen, so der Autor in der Podiumsdiskussion, würden oft nur Titel und erste Sätze lesen. Oder, wie Mary Fulbrook in ihrem Beitrag beklagt, Thesen falsch interpretieren, um sie anschließend hinwegzufegen. Auch die britische Historikerin setzt mit ihrer „Anatomie der Diktatur“ nicht im Zentrum der Macht an, sondern an den Rändern, bei den „Aushandlungsprozessen“ im ganz normalen Alltagsleben. Vielversprechende Ansätze, die der Theologe und Philosoph Richard Schröder kategorisch ablehnt:
„Die Engländerin oder Amerikanerin, das weiß ich nicht mehr, deren Namen ich nicht aussprechen kann – Follbruk oder Fullbruck – redet sogar von partizipatorischer Diktatur und die meisten Menschen hätten die meiste Zeit ein normales Leben geführt.“
Da hatte auch Schröder nicht genau gelesen – oder war einem Irrtum aufgesessen. Wie auch im Fall der „Aushandlungsprozesse“, die Andrew Port so detailliert untersucht hat:
„Es gibt aber hier einen Beitrag von Andrew Pots, Post? Die ostdeutsche Basis, schreibt er, habe vielfältige Möglichkeiten gehabt auf die interne Entwicklung einzuwirken. Also das ist nun leider so nicht richtig.“
Ein Historikerstreit ist da noch nicht ausgebrochen – aber Andrew Port hat auf jeden Fall für Streit gesorgt:
„Ich habe Wortprotokolle gelesen, wo sie klipp und klar gesagt haben, was ihnen nicht gefällt. Und die Funktionäre an der Basis haben wirklich ihre Politik so geformt, um zu einem gewissen Konsens zu kommen, wie es tagtäglich lief in der DDR. Ich glaube, es ist viel differenzierter und viel interessanter als Sie vielleicht annehmen.“
Mehr zum Thema
————————————————————————————
http://www.deutschlandradiokultur.de/neue-perspektiven-in-der-forschung-die-ddr-als-chance.976.de.html?dram%3Aarticle_id=347282
————————————————————————————
Geschichte – Präsenz von alten Nazis in der DDR kaum diskutiert
(Deutschlandradio Kultur, Religionen, 18.10.2015)
Thüringens DDR-Aufarbeitung – Kritische Aufarbeitung sieht anders aus
(Deutschlandfunk, Kommentare und Themen der Woche, 01.03.2016)
Beschwerdebriefe aus der DDR – Volk an Führung
(Deutschlandradio Kultur, Interview, 18.02.2016)
Doktorandenforum in Potsdam – Junge Historiker forschen gern am Rand
(Deutschlandradio Kultur, Zeitfragen, 17.02.2016)
Konsum in der DDR – Bückware und leckende Milchtüten
(Deutschlandradio Kultur, Zeitfragen, 02.09.2015)
Antisemitismus, Rassismus und Neonazismus in der DDR.- Zur notwendigen Selbstkritik des Antifaschismus
Einst waren sie Staatsgeheimnis, bis heute werden sie verleugnet und verdrängt: Mittlerweile sind über 8000 neonazistische, rassistische und antisemitische Propaganda- und Gewalttaten in der DDR belegt. Seit 1990 gab es über 250 Tote und tausende Verletzte durch rechte Gewalttaten und die Täter kommen, gemessen an der Einwohnerzahl, im Verhältnis 3:1 aus dem Osten. Die antifaschistischen Kräfte vermochten bisher nicht, auf diese Entwicklung nennenswerten Einfluss zu nehmen. Höchste Zeit für Selbstkritik antifaschistischer Theorie und Praxis.
Ein Vortrag von Harry Waibel
gehalten am 18. Februar 2016 in Stuttgart
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Die anhaltende Bildungsresistenz von DDR-Nostalgikern